Erfahren und kompetent
Wir stehen Ihnen als beratende und prozessierende Anwälte oder Mediatoren zur Verfügung. Aufgrund Ihrer Interessen und Bedürfnisse, Ihrer finanziellen Möglichkeiten sowie der Einschätzung der einvernehmlichen Einigungschancen führen wir mit Ihnen eine Mediation durch oder beraten Sie rechtlich. Für eine Prozessbegleitung analysieren wir die Chancen und Risiken sowie die mutmasslichen Prozesskosten.
Allgemein kann gesagt werden, dass langwierige Prozesse psychisch und finanziell belasten, erheblich länger dauern und teurer zu stehen kommen als Mediationen und aussergerichtliche Einigungen. Nutzen Sie unsere Stärken im Ausarbeiten von massgeschneiderten, nachhaltigen Verhandlungslösungen.
Pauschalangebote
-
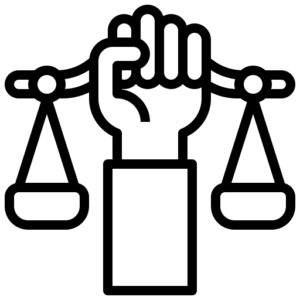
Paket Light
CHF 280.00- Beratung per E-Mail
- Prüfung Ihrer Rechtsfragen
- Verfassen einer rechtlichen Beurteilung/Factsheet
-
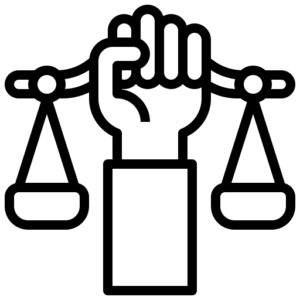
Paket Standard
CHF 360.00- Beratung per E-Mail
- Prüfung Ihrer Rechtsfragen
- Schreiben an Drittperson
-
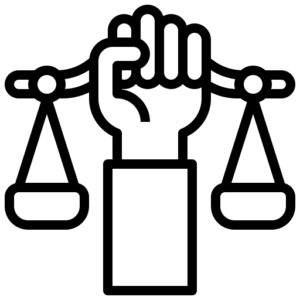
Paket Plus
CHF 480.00- Persönliche Besprechung (Persönlich/Videocall/Telefon)
- Prüfung Ihrer Rechtsfragen
- Schreiben an Drittperson
